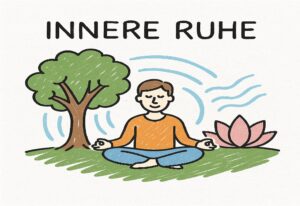Emotionale Intelligenz als Faktor bei strategischen Entscheidungen
Lange Zeit galt die Annahme, dass wichtige Unternehmensentscheidungen ausschließlich rational und faktenbasiert getroffen werden. Neuere Untersuchungen – wie die systematische Übersichtsarbeit „Wenn Gefühle den Kurs bestimmen: Emotionen in Aufsichtsräten“ – widerlegt dieses rein rationale Bild.
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Emotionen einen erheblichen Einfluss, somit auch Einfluss auf die Qualität strategischer Entscheidungen, haben. Positive Gefühle (z. B. Begeisterung oder Vertrauen) können Zusammenarbeit und Kreativität fördern, während negative Gefühle (z. B. Ärger oder gar Angst) Risiken bewusster machen oder Konflikte verschärfen. Ein zentraler Befund der Studie ist die Bedeutung der emotionalen Intelligenz von Führungskräften. Personen in leitender Funktion, die ihre eigenen Emotionen verstehen und steuern können, treffen nachweislich fundiertere Entscheidungen. Tatsächlich untermauert Daniel Goleman, dass emotionale Intelligenz effektive Führung unterstützt, indem sie Führungskräften hilft, die eigenen Stimmungen zu kontrollieren und so kognitive Funktionen und Urteilsfindung zu verbessern. Kurz gesagt: Emotionen sind grundsätzlich kein Störfaktor, sondern ein integraler Bestandteil guter Entscheidungen – insbesondere in komplexen Gremien wie Vorständen oder Aufsichtsräten, wenn sie als emotionale Kompetenz durch bewusste Maßnahmen geschult wurde.
Stärken-Stärken: Emotionale Kompetenz als Schlüssel für wirksame Führung
Viele Führungskräfte verfügen bereits über ein gutes bis hohes Maß an emotionaler Kompetenz – sie können sich in ihre Mitarbeitenden einfühlen, Stimmungen im Team erkennen und angemessen reagieren. Doch gerade diese Stärke wird oft als selbstverständlich betrachtet. Dabei liegt genau hier ein entscheidender Hebel für wirksame und gesunde Führung: Stärken zu stärken bedeutet, vorhandene emotionale Fähigkeiten bewusst weiterzuentwickeln, damit hinderliche Spanungsfelder erst garn nicht entstehen und man schneller ans Ziel kommt.
Führungskräfte, die ihre vorhandene emotionale Kompetenz ausbauen/kultivieren, schaffen ein Klima von Vertrauen, Motivation und psychologischer Sicherheit. Sie können Konflikte früh erkennen, konstruktiv steuern und bleiben auch unter Druck empathisch und klar.
Im Mentalcoaching zeigt sich: Wer bereits über eine ausgeprägte emotionale Intelligenz verfügt, profitiert besonders, wenn er lernt, diese Kompetenz gezielt einzusetzen – nicht als Schwäche, sondern als strategische Stärke. Emotionale Kompetenz kann zwar ein angeborenes Talent sein, ist allerdings zu 100% eine trainierbare Ressource. Und sie ist heute mehr denn je ein entscheidender Erfolgsfaktor für nachhaltige Führung. Darum ist es wichtig diese Stärke durch Schulung bewusst zu verbessern.
Selbstregulation und Empathie
Eigene Emotionen managen, um andere zu verstehen
Eine wichtige Kompetenz emotional intelligenter Führungskräfte ist die Emotionsregulation, also die Fähigkeit, die eigenen Gefühle bewusst zu steuern. Gute Führungskräfte unterscheiden sich von durchschnittlichen oft dadurch, dass sie sowohl positive als auch negative Emotionen „im Griff“ haben und überlegt statt impulsiv reagieren. Sie unterdrücken Emotionen somit nicht einfach, sondern gehen achtsam mit ihnen um.
Untersuchungen bestätigen den Nutzen solcher Selbstkontrolle – Führungskräfte, die ihre Stimmungslagen kontrollieren können, bewahren in Stresssituationen einen klaren Kopf und fällen noch ausgewogenere Entscheidungen. Zudem sind sie eher in der Lage, eine stabile, ruhige Teamatmosphäre zu schaffen, in der sich Mitarbeitende sicher fühlen. Denn Emotionen sind ansteckend: Wenn Führungskräfte auch unter Druck Gelassenheit und Zuversicht ausstrahlen, überträgt sich diese Ruhe oft auf ihr Team.
Eng verknüpft mit der Selbstregulation ist die Empathie, also die Fähigkeit, die Gefühle und Perspektiven anderer nachzuvollziehen. Nur wer die eigenen Emotionen versteht und steuert, kann sich wirklich offen den Emotionen seines Gegenübers widmen. Emotional intelligente Leader zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Gefühle anderer wahrnehmen und berücksichtigen, anstatt ausschließlich auf Zahlen oder Fakten zu achten. Studien zeigen, dass Führungskräfte mit hoher emotionaler Intelligenz – und damit ausgeprägter Empathie – besser kommunizieren, Konflikte erfolgreicher entschärfen und ein positives Arbeitsklima fördern können. Indem sie ihre eigenen Emotionen regulieren, schaffen sie die Voraussetzung dafür, aktiv zuzuhören und mitfühlend auf Mitarbeiter*innen einzugehen. Dies verbessert nicht nur das gegenseitige Verständnis, sondern führt auch zu durchdachteren Entscheidungen: Empathische Führungskräfte bedenken die Auswirkungen ihrer Beschlüsse auf die Mitarbeiter und treffen somit oft nachhaltigere, akzeptiertere Entscheidungen.
Zwischenzeitliches Fazit: Führungskräfte sollten also bei sich selbst anfangen – denn erst die Kontrolle der eigenen Gefühlslage ermöglicht es, die Emotionen anderer bewusst wahrzunehmen und in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.
Schlüsselkompetenzen emotionaler Intelligenz für Führungskräfte
Bei der Auswahl und Entwicklung von Führungspersonen sollten gezielt jene emotionalen Kompetenzen berücksichtigt werden, die nachweislich mit Führungserfolg und Entscheidungsqualität zusammenhängen. Goleman (1995) identifizierte bereits fünf Kernbereiche emotionaler Intelligenz, die bis heute als relevant gelten: Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung, Empathie, soziale Kompetenz (Beziehungsmanagement) und Motivation. Ähnlich beschreibt auch M. Trinidad Sánchez-Núñez Phd, dass zentrale EI-Komponenten für Top-Manager*innen, Selbstbewusstsein, das Management eigener Emotionen, Empathie, sowie soziale Fähigkeiten, sind – um Mitarbeiter*innen zu managen und optimal zu führen.
Förderung emotionaler Intelligenz in der Führungskräfteentwicklung
Angesichts der großen Bedeutung emotionaler Kompetenz sollte die Weiterbildung von Führungskräften gezielt darauf abzielen, diese Fähigkeiten zu stärken. Ein zeitgemäßes Trainingsprogramm für (angehende und aktive) Führungskräfte sollte folgende Inhalte und Methoden umfassen:
- Achtsamkeits- und Resilienztraining: Schulungen in Achtsamkeit durch Entspannungsmethoden helfen Führungskräften, ihre Selbstwahrnehmung und Emotionsregulation zu verbessern. Studien zeigen, dass schon kurze, regelmäßige Achtsamkeitsübungen die Fähigkeit stärken, aufkommende Gefühle bewusst wahrzunehmen und nicht von ihnen überwältigt zu werden.
- Reframing (Umlenken negativer Gedanken in konstruktive Bahnen) gehört ebenso zu Stressmanagement-Strategien, die es ermöglichen in emotional aufgeladenen Situationen ruhiger und klarer zu agieren.
- Selbstreflexion und Feedback: Ein weiterer Baustein ist die Förderung von Selbstwahrnehmung durch strukturierte Reflexion. Dies kann durch Coaching, Tagebuchführen oder 360°-Feedback erfolgen. Einige Fragen, die man sich stellen kann:
Welche Auslöser bringen mich aus der Fassung?
Warum reagiere ich in bestimmten Situationen gereizt oder ängstlich?
Wie könnte ich es beim nächsten Mal anders machen?
Durch solche und mehr Fragen entwickeln sie ein tieferes Verständnis ihrer emotionalen Trigger und können gezielt an sich und zukünftigen Stärken arbeiten. - Empathie- und Kommunikationsübungen: Um die soziale und empathische Kompetenz zu stärken, sollten Trainings praxisnahe Übungen enthalten.
Aktives Zuhören ist bspw. zentral: In Form von Rollenspielen oder Gruppendiskussionen.
Achten auf nonverbale Kommunikation.
Diskutieren wie man diese Entscheidungen mit Einfühlungsvermögen kommuniziert - Konfliktmanagement und Teamentwicklung: Da kollektive Emotionen die Dynamik in Teams stark beeinflussen, sollte ein EI-Training auch den Umgang mit Gruppengefühlen behandeln. Hier bieten sich bspw. Techniken wie: de-eskalierende Kommunikation, Mediation, oder perspektivübernehmende Problemlösung, an.
Zusammenfassend sollten Auswahl- und Entwicklungsprogramme für Führungskräfte verstärkt auf solche emotionalen Kompetenzen und Soft-Skills ausgerichtet sein. Praktisch bedeutet das, schon im Recruiting auf Hinweise für Empathie, Selbstreflexion und Sozialkompetenz zu achten und diese Fähigkeiten anschließend kontinuierlich zu schulen. Denn durch Integration von Soft-Skills in die Führungskräfteentwicklung entstehen robustere Entscheidungsprozesse, eine positivere Unternehmenskultur und letztlich bessere Leistung und Innovation im Unternehmen. Emotionen und Rationalität sind somit kein Widerspruch – vielmehr bilden sie gemeinsam die Basis für exzellente Führungsentscheidungen.